Das Fahrrad ist die Ikone emissionsfreier Mobilität schlechthin. Doch wie nachhaltig ist unsere Liebe zum Bike wirklich? Wir haben uns 6 Themen rund ums Radfahren angeschaut, neue umweltschonende Ansätze gesucht und uns überlegt, wie wir in Zukunft unterwegs sein wollen.
Autsch! Nachhaltigkeit. Irgendwie fürchtet man, dass alles, was jetzt kommt, schmerzhaft und unangenehm werden könnte. Einerseits pedaliert man mit dem Rad auf der Sonnenseite des Diskurses. CO2-, Platz-, und Lärm-sparend – das Bike ist ein Eckpfeiler der ökologischen Transformation. Andererseits ahnt man schon, dass im Windschatten dieses Positiv-Images eine teils obszöne Materialschlacht um minimale Performance-Vorteile, differenzierende Features und technologische Innovationen tobt. Wenn dann die ressourcen-intensiv produzierten und teuer erkauften Marginal Gains im schicken neuen Leibchen auf Malle spazieren gefahren werden, wird der Riss zwischen nachhaltigem Anspruch und konsumistischer Wirklichkeit so groß, dass man fast schon ein neues MTB-Fully braucht, um ihn zu überspringen. Aus Carbon natürlich. Autsch!

Schmerzhaft ist der Gedanke übrigens nicht nur für diejenigen, die diesen Text lesen, sondern auch für den, der ihn schreibt. Denn auch wir als Magazin befeuern den Wunsch nach Neuem und neigen dazu, den innovativen Charakter von Bikes, Parts oder Klamotten an der Performance im Grenzbereich und nicht an der schwer zu beurteilenden Langlebigkeit oder der Reparaturfreundlichkeit festzumachen. Es geht uns daher nicht darum, mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen oder ihn (den Finger!) in bereits offene Wunden zu legen, sondern ein anderes Bewusstsein zu schaffen und zu reflektieren, auf welchen Gebieten es Ideen und Impulse gibt, die uns aus diesem Dilemma herausführen können.

Overengineering vs. Ökologischer Fußabdruck
Radfahren ist DIE Trumpfkarte, wenn es um die Mobilität der Zukunft geht. Eine lange theoretische Nutzungsdauer steht überschaubaren produktionsbedingten CO2-Emissionen gegenüber. Aluminium und Carbon haben Stahl als Material im Rahmenbau dabei weitestgehend verdrängt. Die ökologische Bilanz hängt hauptsächlich von der Laufleistung ab. Ein intensiv genutztes Carbon-Bike kann daher theoretisch eine bessere Ökobilanz aufweisen als ein Alu-Hobel. Bei einem Carbonrahmen gibt es auch keine andere Alternative, als ihn so lange wie möglich zu fahren und dann – wegzuwerfen. Denn anders als Aluminium lässt sich Carbon nicht recyceln. Die Nachhaltigkeitsdebatte geht also über die Lebensdauer eines Produktes hinaus – oder beginnt sie dann sogar erst?
Und wie sieht es eigentlich beim E-Bike aus? In der Bilanz ist auch das Elektrofahrrad ein ökologischer Heilsbringer, allerdings zeigt sich hier ein Trend, der viele Innovationen in der Bike-Branche kennzeichnet. Mehr Drehmoment und mehr Reichweite haben zu überdimensionierten elektronischen Wuchtbrummern geführt, deren Potenzial in den seltensten Fällen ausgereizt wird. Es gilt: Haben ist besser als Brauchen. Der große Akku wird aus Reichweitenangst gekauft, nicht zwangsläufig, weil man tatsächlich so weit fährt. Das Resultat: Da wir meist mehr wollen als wir brauchen, vergrößert sich unser ökologischer Fußabdruck!
In Kombination mit der Elektronik, vielen proprietären Parts und hoher Komplexität sind Akku und Motor unabhängig von Kapazität oder Leistungsstärke auch genau die Teile, die eine Reparatur erschweren, die Lebensdauer beschränken und die Entsorgung verkomplizieren. Das ist bei der neuen Generation minimalistischer, vollintegrierter Light-E-Bikes nicht anders.
Vielleicht besteht die nächste Innovation ja irgendwann nicht mehr aus besseren Leistungskennzahlen und einer einzigartigen Systemintegration, sondern aus einem einheitlichen Ladeport-Standard und zuverlässigen Systemen? Unsere aktuellen E-Mountainbike-Vergleichstests zeigen, dass die Fehlerquellen respektive -meldungen bei einigen Motorherstellern in die Höhe schießen und teils Technologien verbaut werden, die schlicht noch nicht marktreif sind. Das nervt nicht nur den Kunden, sondern erhöht auch den Wartungsaufwand.
Der Gedanke zielt auf einen Aspekt, der in Bezug auf Nachhaltigkeit in vielen Fällen relevanter ist als die bei der Produktion verbrauchten Ressourcen oder der Stromverbrauch im Alltag – die reale Nutzungsdauer. Eine Lifecycle-Studie kommt hier beim Thema E-Bikes zu folgendem Ergebnis:
„Die große Dynamik des Marktes durch regelmäßige Innovationen, Produktneuerungen und der Mangel an Ersatzteilen für ältere Modelle machen die langfristige Nutzung durch die Kunden viel schwieriger als bei herkömmlichen Fahrrädern.“

Die Nutzungsdauer ist der Part der Gleichung, der in der Praxis darüber entscheidet, ob ein Produkt nachhaltig ist oder nicht. Bei Bikes und insbesondere bei E-Bikes hängt diese weniger von der Robustheit des Rahmens als von der Anfälligkeit bzw. Reparatur- und Upgrade-Fähigkeit der Komponenten ab. Mehr Standard-Parts, die eine höhere Entwicklungstiefe, eine garantierte Ersatzteilversorgung und längere Produktlebenszyklen besitzen, können ein Teil der Lösung sein. Eine andere Markenkommunikation und Produktpolitik der Hersteller und ein neues Mindset bei den Konsumenten gehören aber genauso dazu. Statt Produkt-Innovation braucht es vielmehr Innovationen im Geschäftsmodell.
Denn selbst, wenn man ein E-Bike reparieren lassen könnte, kann man es dann leider doch nicht immer bzw. jederzeit reparieren lassen. Wer seinen online oder gebraucht erworbenen Elektro-Hobel mit defektem Motor zur lokalen Fachwerkstatt wuchtet, dem wird oft unmissverständlich klar gemacht, dass es diesen Frühling mit einem Termin eher finster aussieht und man bei dieser Marke eh nicht weiterhelfen kann. Es reicht also nicht aus, viele (teure) Räder zu verkaufen, es werden auch Werkstätten gebraucht, um die Räder zu reparieren. Das Geschäftsmodell, ein komplexes E-Bike online anzubieten und Service und Reparatur nicht mitzudenken, ist daher grundsätzlich nicht nachhaltig und ähnelt mehr einer Wegwerfmentalität.
Das musste auch die niederländische Marke VanMoof erkennen, die als „Tesla der Bike-Welt“ Großes bewegen wollte, aber durch die vielen proprietären Parts und die fehlende Service-Infrastruktur an Grenzen gestoßen ist. Denn wenn die teuren und urbanen E-Boliden mit Defekt im Keller verstauben, ersetzen sie keine Autofahrten.
High-End vs. High-Quality
Der Trend zu immer performanteren Bikes, innovativen Komponenten und steigendem Wartungsaufwand ist jedoch keinesfalls E-Bike-spezifisch. Er verstärkt sich grundsätzlich, je weiter wir uns von der Idee des Fahrrads als „Transportmittel“ entfernen, und er führt paradoxerweise dazu, dass sich die Haltbarkeit und Lebensdauer von High-End-Komponenten verringert. Superschmale 12-fach-Ketten treffen auf rapide verschleißende 9-fach-Ritzel, ultra-bissige Bremsbeläge müssen oft schon nach 1.000 km (oder 1.000 Downhill-Höhenmetern auf dem MTB) gewechselt werden, und komplette Kurbelgarnituren werden – samt des teuren Powermeters – getauscht, wenn ein Kettenblatt abgefahren ist.
Für den Rennsport beschreibt der ehemalige Straßen-Profi David Millar das Paradoxon wie folgt: „A lot of the pro racing stuff is almost disposable.“ Was so viel bedeutet wie: Die teuersten Parts bieten zwar kurzfristig die maximale Performance, aber halten nicht lange. Was in Bezug auf ein paar Tausend professionelle Athleten weltweit ressourcen-technisch noch zu verschmerzen wäre, wird zum Problem, wenn die Parts zum Statussymbol für die breite Masse der Bike-Begeisterten avancieren und dort oft genug für Enttäuschung sorgen.
Heute werden mit einem unübertroffen hohen Aufwand an Ressourcen Teile hergestellt, die eine unübertroffen hohe Leistung, aber auch eine unübertroffen geringe Lebensdauer haben. Die Lösung ist die Erweiterung des Performance-Begriffs um den Langlebigkeits-Gedanken oder einfach gesagt: die Rückkehr zur Qualität als Normalität. Niemand käme auf die Idee, eine Waschmaschine als Premium-Produkt zu bezeichnen, die die Wäsche besonders rein wäscht, nur um sich dann nach einem Jahr irreparabel ins Waschmaschinen-Nirvana zu verabschieden.

Tour de France vs. Tour de Pfalz
Mehr als 6 Watt pro Kilo leisten die Profis auf Tour-Anstiegen, und mehr als 43 Kubikmeter Müll pro 150 km Strecke schmeißen die Zuschauer dabei in die Landschaft. Auf jedes Rad, das am Start steht, kommen 12 Begleit-, Organisations- oder Werbefahrzeuge. Am Ende steht ein CO2-Ausstoß, der dem Jahrespensum einer Kleinstadt entspricht. Die Tour de France ist ein sportliches Mega-Event. Dabei begann sie einmal als das, was man heute „self-supported gravel-race“ nennen würde.
Egal, ob Tour de France, MTB-Weltcups oder Gravel-Abenteuer – Rennen ziehen uns in ihren Bann – zu Recht. Wir lassen uns mitreißen, zu eigenen Höchstleistungen anstacheln und können mit anderen teilen, was wir lieben. Doch manchmal werden große Events auch zu simplen Trophäen in der Strava-Vitrine. Wir machen mit, um sie von der Bucket-Liste der eigenen Ambitionen streichen zu können und uns im Freundeskreis-internen Power Ranking nach oben zu arbeiten. Ötztaler in unter 9 Stunden? FETT!!!
Doch die meisten ikonischen Events beginnen mit einer epischen Anreise. Ob mit dem Auto zum Alpenmarathon oder gar mit dem Flieger zum Cape Epic nach Südafrika. Bevor wir Laktat produzieren, produzieren wir CO2. Doch ein Alpenpass ist nicht das einzige Abenteuer, das einen auf dem Rennrad erwartet, und auch ein Everesting auf dem Hausberg taugt als Statussymbol, Trainingsziel oder Saisonhöhepunkt.
Corona hat neben dem Everesting noch weitere extrem biestige Bike-Formate entstehen lassen. Ob Everesting 10.000, bei dem du – du ahnst es bereits – die Höhenmeter-Bilanz 5-stellig machen darfst, oder Orbit360, einer Gravel-Serie die extrem herausfordernde Strecken in jedem Bundesland bietet, du startest die Rides vor deiner Haustür. Daneben gibt es noch eine enorme Anzahl von Jedermannrennen, lokalen Kriterien oder den guten alten Radtourenfahrten (RTFs) – alle mit viel Herzblut von lokalen Vereinen organisiert und meist mit einem Kuchen-Catering, von dem du auf einem Großereignis nur träumen kannst.
Und noch einen Schritt weitergedacht. Braucht man immer eine von anderen definierte Challenge, um sich selbst zu fordern? Oder kann man sich nicht auch allein oder zusammen mit Freunden eigene Ziele setzen? Dabei geht es nicht darum, irgendjemandem seinen Traum vom Ötztaler madig zu machen, sondern das, was uns am Biken kickt, um eine neue, eigene Dimension zu erweitern.

Gute Absichten vs. Böse Folgen
„Don’t buy this jacket“, stand 2012 frech auf einer Anzeige des Labels Patagonia. Darunter eine Fleecejacke. Die Botschaft dahinter: Hinterfrage dein Konsumverhalten, triff bewusste Entscheidungen und konsumiere weniger. Die Jacke war sofort ausverkauft.
Es scheint, dass uns nichts mehr zum Konsum motiviert als die Aussicht, damit auch noch die Welt zu verbessern. Der Patagonia-Gründer Yvon Chouinard konstatierte, dass jedes Mal, wenn er eine gute Entscheidung für den Planeten traf, er am Ende damit selbst ein gutes Geschäft machte. Zu bewerten, ob die Entscheidung zum Konsumverzicht aufzurufen, selbst wenn sie den Konsum steigert, wirklich gut für den Planeten ist, würde hier den Rahmen sprengen. Aber die Kampagne hat das Image von Patagonia als verantwortungsbewusstes und nachhaltig denkendes Unternehmen zementiert.
Wir versammeln uns gerne hinter Öko-Labels, verweisen auf Recycling-Versprechen der Hersteller und werfen schnell noch das Wort „Ocean Plastic“ in die Runde, bevor wir auf „Kaufen“ klicken. Aber macht das die Sache wirklich besser? Oder bleibt es nur bei einem Gefühl, das wir gar nicht hinterfragen wollen?
Geiler Style vs. Guter Stoff
Recycling ist das Zauberwort, das aus bösem Plastik scheinbar gutes Plastik macht. Das Ziel, auf neues PET zu verzichten, ist richtig. Denn so endlich die Ressourcen sind, die wir brauchen, um Plastik herzustellen, so unendlich ist das Material selbst. Plastik verschwindet nicht, es zerfasert lediglich zu mikroskopisch kleinen Teilen. Dieses Mikroplastik gerät ins Wasser, in die Nahrung und schließlich in unseren Körper.
Diese Überlegungen spiegeln sich auch in den neuen Strategien der Apparel-Brands wider. So hat sich Branchenriese Adidas vorgenommen, bis 2024 kein Neuplastik mehr zu verwenden, und außerdem Funktionsfasern entwickelt, die weniger Mikrofasern in die Umwelt abgeben sollen. Die meisten Brands haben mittlerweile eine Produktlinie oder eine komplette Kollektion aus recyceltem PET im Angebot und versuchen, auch Verpackung und Versand plastikfrei zu gestalten.
Das Mikroplastik-Problem wird jedoch durch Recycling allein nicht gelöst. Kleidung aus recyceltem Plastik gibt beim Waschen sogar tendenziell mehr Mikrofasern ins Wasser ab als Textilien aus neuem PET, da sich die alten, vorstrapazierten Fasern schneller auswaschen.
Doch welche Alternativen gibt es? Mit Merinowolle hat in den letzten Jahren ein Material ein Revival erlebt, das den Radsport lange dominiert hat. Merinowolle wärmt auch, wenn sie nass wird, kühlt bei Hitze und stinkt nicht (ganz so doll).
Ein weiteres Thema sind biobasierte und biologisch abbaubare Kunststoffe. Erstere werden aus Biomasse hergestellt, letztere zersetzen sich unter bestimmten Bedingungen rückstandsfrei. Im Bereich der Funktionskleidung finden die Wunderstöffchen jetzt Eingang in die ersten Kollektionen. So verwendet Vaude auf Rizinusöl basierende Bio-Kunststoffe, um herkömmliches Plastik einzusparen, und Kathmandu hat eine abbaubare Daunenjacke entwickelt. Das „Grüne Plastik“ ist ein heißes Thema in der Textilindustrie und hat das Potenzial, eine neue Generation an Produkten zu prägen. Hierzu gehören auch die Laufschuhe des Zen-Running-Clubs, die aus drei pflanzlichen Hauptzutaten – Zuckerrohr, Eukalyptus und Naturkautschuk – hergestellt werden. Ganz auf pflanzliche Zutaten kann man jedoch noch nicht setzen und auch die globale Lieferkette ist noch eine Herausforderung. Auch wenn man gute Entscheidungen treffen will, dauert es noch, bis aus „besser“ wirklich „gut“ wird. Bis es soweit ist, bleibt die entscheidende Stellschraube in der textilen Nachhaltigkeit das eigene Verhalten.
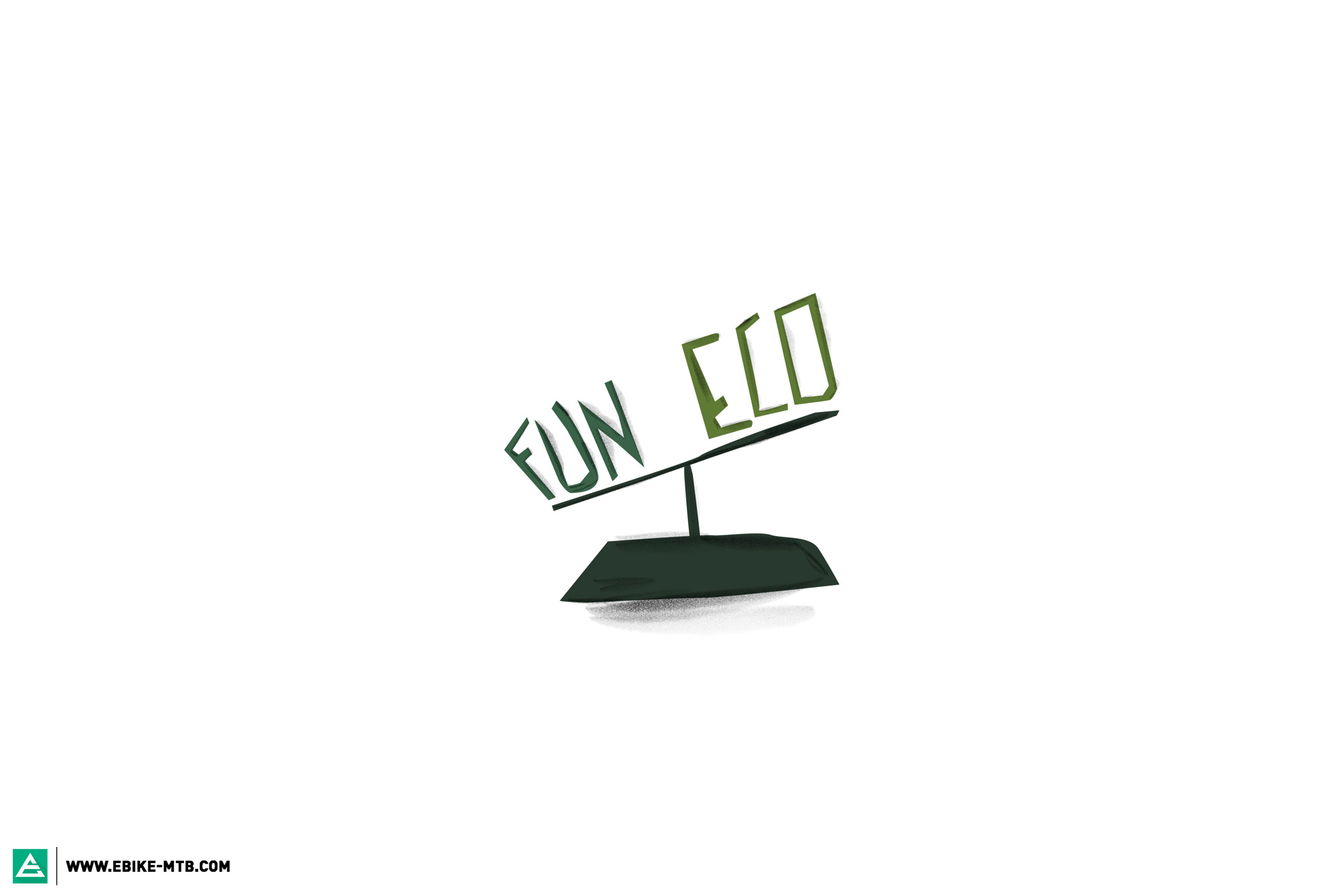
Wollen vs. Brauchen
Vieles, was wir wollen, brauchen wir nicht. Hersteller wie Patagonia oder Velocio versuchen, ihren Kunden vor Augen zu führen, dass bewusster Kauf und damit auch der Kaufverzicht der Weg zum Konsumglück sind. Andere setzen auf Second-Hand-Plattformen – ja, für Fahrradklamotten –, präsentieren in Dokuformaten ihre Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit oder lassen vor Produktionsbeginn der neuen Kollektion „pre-ordern“, um hinterher keine Ware verramschen oder wegschmeißen zu müssen. Wie viel davon Marketing ist? Bestimmt einiges.
Vielleicht ist das aber letztlich auch egal. Etwas lange zu besitzen, zu pflegen, richtig zu waschen – also auch weniger zu waschen – zu reparieren und wirklich wertzuschätzen, kann sehr befriedigend sein. Wenn es zum Trend wird, mit den eigenen Bikes und dem eigenen Equipment so umzugehen, dann steckt da sicherlich mittelfristig mehr Freude drin als in der erfolgreichen Schnäppchenjagd.
Alles was wir tun, hat Folgen – für uns, für andere, für die Umwelt. Die Balance zwischen Freude und Folgen muss jeder für sich finden und ab und zu neu mit sich selbst aushandeln. Dabei muss man auch mal Widersprüche aushalten können. Denn es wäre schade, etwas Richtiges nicht zu tun, weil man nicht alles richtig machen kann oder will. Was wir aber tun können, ist das, was wir besitzen, mehr wertzuschätzen, nicht jedem Marketing-Versprechen hinterherzurennen und trotzdem offen für neue Anregungen zu bleiben.
Hat dir dieser Artikel gefallen? Dann würde es uns sehr freuen, wenn auch du uns als Supporter mit einem monatlichen Beitrag unterstützt. Als E-MOUNTAINBIKE-Supporter sicherst du dem hochwertigen Bike-Journalismus eine nachhaltige Zukunft und sorgst dafür, dass der E-Mountainbike-Sport auch weiter ein kostenloses und frei zugängliches Leitmedium hat! Jetzt Supporter werden!
Words: Nils Hofmeister Photos: Julian Lemme









